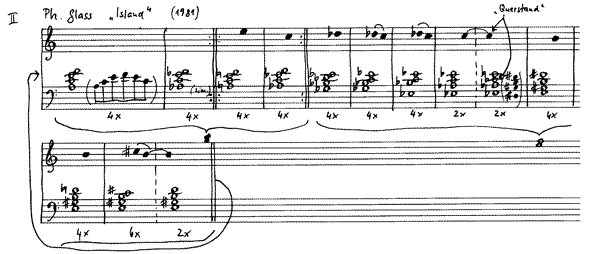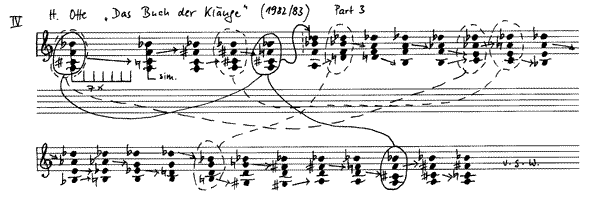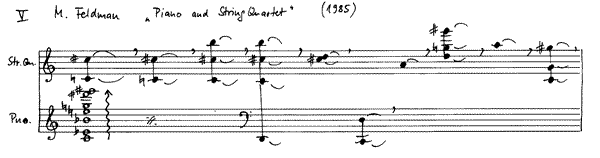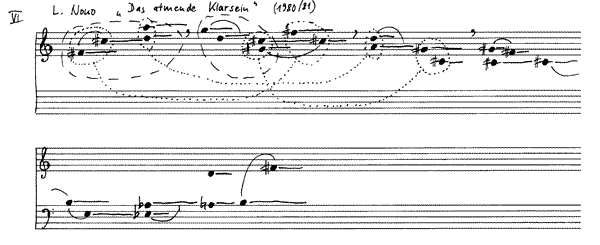über die Reduzierung der kompositorischen Mittel
|
Versucht man rückblickend in der Entwicklung der Neuen Musik der vergangenen 20 Jahre eine übergreifende Gemeinsamkeit auszumachen, so muß man auf den ersten Blick wohl resignieren, denn zu unübersichtlich haben sich die verschiedenen Artikulationsformen kompositorischen Denkens verästelt. Gab es in den 50er und 60er Jahren noch das einheitsstiftende Postulat seriellen und konsequent experimentellen Klangforschens, so scheint heute das Koordinatensystem eines fest umrissenen, zeitgemäßen kompositorischen Vokabulars zusammengebrochen zu sein. Alles geht, nichts ist unmöglich! Die Individualisierung im politisch- gesellschaftlichen Leben scheint in der Kunst ihren Spiegel zu finden. Ein linearer Fortschritt bewegt sich unweigerlich auf sein eigenes Ende zu. Doch jeder Zusammenbruch setzt neue Energien frei, die sich oftmals nach den physikalischen Gesetzen der Pendelbewegung gegenläufig zum Vorherigen verhalten. Zwar gliedern sich musikgeschichtliche Entwicklungen nicht fest umrissen, sondern überlappend und fließend, dennoch scheint es etwa um 1970 herum eine spürbare Wandlung der kompositorischen Ansätze zu geben. Die damals jungen Komponisten begannen sich von ihrer Vätergeneration abzusetzen; Orientierungsmarken waren nicht mehr Webern und in dessen Folge das, was man die „Darmstädter Schule” getauft hatte, jetzt berief man sich auf Mahler. Dies war zwar vor allem ein speziell bundesrepublikanisches Phänomen, aber gleichzeitig begann auch hier eine umfassendere Rezeption der Musik von John Cage. Ihr radikal gegenläufiger Ansatz zur damaligen westeuropäischen Avantgarde brachte die Denkfabriken seriellen Komponierens ins Wanken und lehrte den Apologeten struktureller Komplexität mit dem Prinzip Zufall wie einem trojanischen Pferd das Fürchten. Und mit der damals ebenfalls aus Amerika herüberschwappenden Welle der sogenannten Minimal Music (ich erwähne hier nur als spektakulärstes Beispiel „Drumming” von Steve Reich aus dem Jahr 1971) begann sich ein Virus auszubreiten, der auch altgestandene Avantgardisten infiszierte: so bezieht sich das mittlere Stück der Drei Stücke für zwei Klaviere (1976) von G. Ligeti explizit auf Steve Reich und Terry Riley. Nun wurde auch der normale Dreiklang - lange als verstaubt verpönt - wieder hoffähig. In diesem Zusammenhang ist auch an die Diskussion um die „Neue Einfachheit” zu erinnern, die sich als durchaus fragwürdiges Etikett eher als eine journalistische Seifenblase denn als haltbare Definition kompositorischer Befindlichkeit entpuppte. Dennoch umriß diese Formel bedingt ein Phänomen der sich wandelnden Komponiertendenzen: die Abkehr von der rein intellektuellen Legitimation kompositorischen Handelns. Unter Vorgabe einer allgemeineren Verständlichkeit lichteten sich die Partituren wieder aus einer zum Teil überbordenden Komplexität zu faßlicheren und vertrauteren Strukturen; man wollte aus dem engen Zirkel der Insider-Veranstaltungen ausbrechen und auch wieder beim normalen Abonnementspublikum Gehör finden. Eher eine Ausnahme und mehr Randerscheinung blieben dabei Streichquartette in D-Dur im Stil des ausgehenden 18. Jahrhundert wie bei L. Kupkovic oder der schumaneske Romanzen-Tonfall in den neueren Stücken von W, Killmayer. Das vermehrte Auftauchen von traditionellen Versatzstücken in den neueren Partituren rechtfertigte jedoch scheinbar den aus der Architektur entlehnten Begriff der Postmoderne, der nun der Terminus technicus für das Auftauchen einer eher rückwärts gewandten Komponierhaltung wurde. Ich will hier nicht auf die grundsätzliche Problematik eingehen, die mit diesem Begriff in der Diskussion mehr Verwirrung als Klärung geschaffen hat. Aber so verschieden die divergierenden Strömungen seit 1970 auch gewesen sein mögen, so auffällig war doch die Veränderung, die sich schon an der Wahl der Titel artikulierte; es wurden wieder Konzerte, Sinfonien, Opern und Streichquartette komponiert und die Stücke hießen nicht mehr „Structures” oder „Kreuzspiel” sondern „Traumformel” und „Rituel”. Figuren wie Lachenmann und Hespos vertraten weiterhin radikal und konsequent die ästhetische Position des Klangforschens in der Tradition der für sie nicht gealterten Avantgarde. Sie haben mit ihrer widerborstigen Musik die Szene der vergangenen Jahre bereichert.
B. A. Zimmermann, ein Komponist, der schicksalhaft zwischen zwei Generationen stand, komponierte 1970 - im Jahr seines Freitodes - die Orchesterskizzen „Stille und Umkehr”. Dieser Titel könnte wie ein Motto über der Entwicklung stehen, die als ein Strang zu dieser Zeit in der Musik einsetzte: Besinnung, Reduktion, Konzentration, Innerlichkeit, Meditation, dies waren Werte, die - wie auch immer ausgelegt - zum Movens kreativer Energie wurden. Ich möchte nun ausgehend von diesem letzten reinen Orchesterwerk Zimmermanns ein wenig eingehender dieses Phänomen der Reduktion der kompositorischen Mittel untersuchen. Anhand von fünf weiteren Klang-Beispielen aus den 80er Jahren möchte ich die Unterschiedlichkeit dessen aufzeigen, was bei oberflächlicher Betrachtung den gleichen Ansatz zu haben scheint. Ich will mich dabei ausschließlich auf die Klangphänomene stützen und programmatisch inhaltliche Hintergründe der einzelnen Stücke einmal außer Acht lassen. Die Auswahl ist mehr zufällig, sie könnte daher beliebig erweitert werden und somit die Aspekte des Phänomens Reduktion weiter differenziert werden. Die gebotene Zeit läßt nur kurzes Anspielen der Beispiele zu, ich versuche aber musikalisch sinnvoll auszublenden. Hören wir also zunächst ein paar Takte des erwähnten Orchesterwerkes von B. A. Zimmermann:
B. A. Zimmermann, „Stille und Umkehr“ (1970)
Dies waren die ersten 24 Takte. Auffälligstes Merkmal dieses ersten formalen Abschnittes der Komposition ist der Orgelpunkt ’D’, der übrigens durchgehend bis zum Ende des gut 10-minütigen Stückes gehalten wird und nur durch variierte Instrumentation im weiteren Verlauf seine Farbe und somit auch seinen Ausdruckswert verändert. Hier im ersten Abschnitt ist es der gleichförmig wiederkehrende Farbwechsel von Quartflageolett auf dem Solo-Kontrabaß, gekoppelt mit der 3. Flöte und dem Quintflageolett von drei Violoncelli. Der statische Eindruck wird verstärkt durch die ebenfalls regelmäßig, insgesamt 12-mal wiederkehrenden Arabesken der Flöte 1 und 2, die zusammen mit dem Anfangsimpuls von Harfe wie ein figurierter Einschwingvorgang des Haltetons ’D’ wirken. Die Einsatzabstände der ”huschenden” Flötenfiguren schwanken zwischen 8 1/2 und 9 Vierteln. Sie gliedern die Zeit in ostinatem Charakter. Die geringfügigen Schwankungen in der Dauer dieser Zeitstrecken lassen die Zeit quasi unmerklich atmen. Die Flötenfiguren beschränken sich in Flöte 1 auf sieben (Cis, D, E, G, As, B, C), in Flöte 2 auf drei Töne (C, D, Es). Beide benutzen das ’C’ nur als Vorschlagsnote und spielen durchgehend eine gleichbleibende Anzahl von Tönen: Flöte 1 neun Triolen-16tel, Flöte 2 sieben Quintolen-16tel.
Als weitere unabhängige Zeitschicht ist diesem statischen Klanggeschehen eine auf kleiner Trommel ausgeführte 8-taktige Blues-Periode unterlegt, die in den gehörten ersten 24 Takten genau dreimal gespielt wird. (Wie der Komponist anmerkt, ist sie unbedingt von einem Jazz-Musiker - mit Handfläche ausgeführt - zu spielen.) Sie durchzieht, wie der Ton ’D’, mit Ausnahme von drei sich gegenseitig aufhebenden Abweichungen gleichförmig das ganze Stück. Konzentriertes Hineinhorchen und ein Blick in die Partitur zeigen, daß hier bei äußerster Reduzierung der kompositorischen Ausdrucksmittel höchst differenziert im Detail der Instrumentation und der zeitlichen Strukturierung das Klanggeschehen gestaltet ist. Es ist eine Musik am Rande des Verstummens, die Unendlichkeit suggeriert, da in der Musik sich eigentlich nichts ereignet, sie verharrt scheinbar ziellos in sich selbst.
Wie anders hört sich die Beschränkung auf wenige kompositorische Mittel im folgenden Klangbeispiel an! Hören Sie den Anfang von
Phil Glass, ”Island” (ca.1982)
Auch hier haben wir einen ostinaten Duktus. Die Musik gliedert sich dabei leicht faßlich und ganz traditionell in 4-Takt-Perioden mit tonalen, wellenförmigen Dreiklangsbrechungen im 3/4tel-Takt. Zunächst erklingt jeweils viermal der Akkordwechsel von a-moll zu As-Dur mit der gemeinsamen Sexte der Skala als Wechselnote. Es folgen Ges-Dur und es-moll (zunächst mit der Terz, dann mit Grundton als unterem Rand), ein Dur-moll-Wechsel in As und zum Schluß für längere Dauer E-Dur, zunächst mit großer Septime, dann kleiner Septime, Sexte und zurück zur Septime. Mit diesem Septakkord schließt sich der Kreis der Akkordfolge dominantisch zum anfänglichen a-moll, und der gleiche harmonische Ablauf mit mediantischen Tendenzen wiederholt sich in unveränderter periodischer Gestalt. Die ab der 5. Periode hinzukommenden Haltetöne oder melodisch fallenden Sekundschritte verwenden ausschließlich Leiter-eigene Töne, nur in der 12. Periode beim Dur-moll-Wechsel in As entsteht kurz eine querständige Reibung von C und Ces (bzw. H bei enharmonischer Umdeutung des as-moll zu gis-moll).
Die gleichförmig monotone metrische Gestalt der Harmoniefolge läßt diese in Gestalt einer Begleitfigur zur eigentlichen Hauptsache werden. Es ist eine Musik ohne Widerhaken, in die sich der Hörer geradezu einlullend einschwingen kann. Auch diese Musik suggeriert in ihrem repetitiven Duktus Unendlichkeit; die harmonischen „Weichspüler-Sexten” sorgen beim Zuhörer für Wohlbefinden beim Sich-Ausklinken aus der Zeit. Dies ist Minimal Music im genuinen Sinne, denn das Prinzip der kompositorischen Idee ist äußerst simpel, aber publikumswirksam, weil nur bekannte Modelle abgerufen werden.
Als nächstes Klangbeispiel hören Sie ein Stück, das ebenfalls der Minimal Music zuzurechnen ist:
Steve Reich, „The Desert Music” (1982/83), Anfang 3. Teil
Wie schon bei Glass ist auch hier ein gleichbleibender metrischer Puls zu fühlen. Ebenfalls finden sich Repetitionsmuster, die allerdings in ihrer rhythmischen Gestalt nicht die monotone Gleichförmigkeit wie bei Phil Glass besitzen. Mit jazzig-swingendem Charakter exponieren die Violinen nach einer kurzen Einleitung der Perkussionsinstrumente eine 12 Achtel dauernde Figur, die zum wesentlichen Baustein (Reich nennt es „Phase”) der weiteren Entwicklung wird. Harmonisch verharrt die Musik für längere Zeit in einem bitonalen Klangfeld aus Es- und F-Dur. Schon bei der 3. Wiederholung dieser ersten Violin-Phase beginnt der Prozeß einer graduellen Verdichtung, indem zunächst die erste und dritte 16tel-Figur im 8tel-Abstand als Echo nachschlägt und dann nach dem gleichen Prinzip des Phasen-Verschiebens die Violinfigur sich zu einem vielstimmig engen Kanon-Geflecht verdichtet. Ohne das harmonische Klangfeld zu verlassen erweitert sich der Klangraum durch Umstellung der Töne nach oben. Als nächstes Ereignis werden zwei lang gehaltene, dynamisch an- und abschwellende Akkorde über dem Baßschritt A -Es darüber gesetzt. Trotz der Mischklänge aus Es-und F-Dur entsteht durch diesen Baßschritt einer verminderten Quint der psychologische Eindruck einer Wendung Dominante - Tonika. Erst hiernach ändert sich erstmals das harmonische Klangfeld (dort, wo ich ausblendete).
Schon dieser erste Anfang läßt erkennen, daß trotz des längeren Verbleibens im gleichen Klangraum, die Binnenstrukturen im Harmonischen und Rhythmischen weitaus differenzierter ausgestaltet sind als bei dem zuvor gehörten Stück von Phil Glass. Diese Musik hat mehr prozeßhaft fließenden Charakter in ihren Werten der schrittweisen Veränderung. Auch die Instrumentation weist ein spürbar höheres Maß an kompositorischem Raffinement aus.
Ich möchte Ihnen nun einen Ausschnitt aus dem „Buch der Klänge” von Hans Otte anspielen. Diese Musik für Klavier ist ganz offensichtlich auch als Reflex auf diese Haltung amerikanischen Musikdenkens zu verstehen, doch sie findet, wie ich meine, eine ganz eigenständige Ausdruckswelt, die letztlich nur noch sehr wenig mit den sonst typischen Merkmalen der Minimal Music zu tun hat. Hören wir den Anfang des 3. Teils:
Hans Otte, „Das Buch der Klänge” (1982/83)
Der introvertiert meditative Charakter dieser Musik ist ganz offensichtlich. Wie in allen zuvor gehörten Klangbeispielen geschieht auch hier grundsätzlich sehr wenig. Im mittleren Klangbereich des Klaviers - etwa um die eingestrichene Oktave herum - werden vierstimmige Akkorde repetiert, wobei sich nach jeweils sieben Schlägen ein (bzw. zwei) Töne im Klang verändern. Dies ist zunächst nichts wesentlich Anderes als bei Phil Glass, denn auch dort binden gemeinsame Töne die Harmoniefolge. Daß hier jedoch ein schwebender, harmonisch stets offener Eindruck entsteht, erklärt sich aus der Wahl der Klänge und der Art des harmonischen Weitergehens. Man hat den Eindruck, sich stets in einem harmonischen Zwischenwert zu befinden; jeder neue, durch Halbtonschritt einer Akkordstimme aufwärts oder abwärts sich ergebende Klang wirkt wie eine alterierte, vagierende Zwischenharmonie: es ist eine merkwürdige Klangwelt zwischen Schubert und Messiaen! Der harmonische Schwebezustand findet seine Entsprechung in der Art der klanglich interpretatorischen Darstellung des Pianisten und Komponisten Otte: trotz des gleichmäßigen Pulsierens scheint die Musik im Dynamischen wie Agogischen zu atmen. Dies unterscheidet sie von den eher kalt perfektionistischen Patterns eines Steve Reich.
Auch die Musik von Morton Feldman wird oftmals - wie ich finde - zu Unrecht der Minimal Music zugerechnet. Zwar gibt es auch bei ihm ein scheinbar gleichbleibendes Klangbild, dessen Veränderungen im Metrischen wie Harmonischen nur bei genauem Hinhören wahrnehmbar sind, auch Wiederholungsmodelle sind bei Feldman nicht selten, doch sie tauchen irregulär auf. Wesentlich unterscheidet sich seine Musik aber darin, daß sie auf einen, wie auch immer gestalteten faßlichen Puls verzichtet. Und auch die Tonalität ist eine völlig andere, sie vertraut nicht allein auf den leicht verdaulichen Wohlklang normaler tonikaler Dreiklangsbildungen. Ich spiele Ihnen den Beginn von
Morton Feldman, Piano and Stringquartet (1985)
an. Es gibt hier eine merkwürdige Affinität zu dem eingangs vorgestellten Beginn von „Stille und Umkehr”: mit einem Bewegungsimpuls (dem Klavierarpeggio) bleiben Haltetöne der Streicher als Nachhall im Raum stehen (senza Vibrato und in fahler Flageolettfärbung). Dies wiederholt sich in ungefährem Abstand von jeweils 9 Sekunden. Der 7-tönige freitonale Klang des Klaviers zu Beginn wird jedes weitere Mal durch Wegnahme einzelner Töne und die graduelle Veränderung der Akkordbrechung variiert. Die Anzahl der nachschwingenden Haltetöne der Streicher schwankt ebenso irregulär zwischen 1 und 4, und es sind nicht nur die akkord-eigenen Töne des Klavierklanges, sondern es tauchen dabei auch - mit Ausnahme des F - die noch fehlenden Töne zur chromatischen Totale auf. Sie wirken allerdings wie ferne Ober- und Untertöne des Klavierklanges. Nach zehn durch den Klavierklang gegliederten Zeitstrecken ändert sich erstmals dessen Harmonik.
Wie bei Zimmermann scheint die Musik sich im äußersten Pianissimo am Rande des Verstummens zu bewegen und das Zeitempfinden gleichsam aufzuheben. Ein merkwürdiges Gefühl irritierend flüchtiger Schönheit geht von dieser Musik aus.
Auch mein letztes Beispiel führt uns in eine Welt fremdartiger Schlichtheit und Schönheit. Doch hören wir zunächst den ersten Chorteil aus:
Luigi Nono, „Das atmende Klarsein” (1980/81)
Diese Musik ist radikal ausgedünnt: nur der Einklang (Unisono), die Quinte und die Quarte als komplementäres Intervall sind die verwendeten, geradezu archaisch anmutenden Klänge. Es entsteht der Eindruck äußerster Transparenz und Reinheit. Beim Hören entzieht sich die Musik jeder metrischen Gliederung: die Zeit scheint stillzustehen. Erst ein Blick in die Partitur läßt die, trotz klanglicher Schlichtheit, höchst differenzierte metrische Fixierung erkennen, die allerdings durch zahlreiche Fermaten von 2 - 5 Sekunden Dauer etwas Irrationales bekommt: die Komplexität der Notation hebt sich hiermit sozusagen selbst wieder auf. Aus ihr spricht aber ein Höchstmaß an Konzentration, die auch an der ebenso detailliert notierten dynamischen Gestaltung und der Artikulation abzulesen ist. Werfen wir kurz noch einen Blick auf die harmonische Seite. Zunächst entsteht vom anfänglichen Fis aufbauend die Quinte Fis - Cis; das Cis bleibt liegen und führt weitersteigend in die Quinte der gleichzeitig einsetzenden Töne D und A. Trotz extremer Zeitdehnung addiert das Ohr diese Töne der kompositorischen Keimzelle zu einer Art fis-moll. Nach einer Atemzäsur von 4 Sekunden entsteht nun nach dem gleichen Prinzip, quasi spiegelbildlich der fallende Quartgang: zunächst nacheinander einsetzend G und D, dann wieder gleichzeitig erklingend Gis -Cis. Durch melodisches Weitergehen des Soprans von Gis aus erscheinen mit Fis und Cis als fallendem Quartgang wieder die ersten beiden Töne. Nach einer erneuten Zäsur beginnt die nächste Phrase mit der Quart A - D als Komplementärklang zum Weitergehen am Beginn. Die sich anschließende fallende Quint Gis - Cis verhält sich wiederum komplementär zur entsprechenden Quart der zweiten Phrase. Schon dieser kurze Blick auf die harmonisch strukturelle Gestaltung des ersten Beginns läßt deutlich werden, daß trotz äußerster Schlichtheit der klanglichen Erscheinung alle Töne auf höchstdifferenzierte Art und Weise aufeinander bezogen sind. So, wie hier komponiert wurde, wird Tonkunst zu dem, was sie im emphatischen Sinn ist! Es kommt auf jeden einzelnen Ton an, auf seine Bedeutung im Zusammenklang in einfachsten Intervallverhältnissen!
Auch wenn die hier von mir ausgewählten Beispiele nur ansatzweise besprochen werden konnten, so denke ich doch, daß die qualitativen Unterschiede deutlich wurden, daß Komponieren mit nur kleinen Bausteinen nicht zwangsläufig eine simple und minimale Musik zur Folge hat. So kann etwas Einfaches durchaus komplex und etwas scheinbar Komplexes durchaus einfach und simpel sein. Die Wertigkeit läßt sich nicht allein am gewählten Material ablesen, sondern sie steht in Zusammenhang mit der geistigen Haltung. Auf diese Haltung kommt es an! Sie entscheidet, wie Musik auf den Hörer ein-wirkt, was sie ausdrückt, was sie mitteilt und wie sie berührt! Um noch einmal die Extreme meiner Beispiele zu bemühen: die sinnliche Botschaft von Glass ist eine andere als die bei Nono. Die eine richtet sich mehr an den Bauch, die andere scheinbar mehr an den Kopf. Im Moment des Erklingens von Musik kommunizieren Autor und Rezipient miteinander. An dieser Nahtstelle, der Gestaltwerdung von Musik, verknüpfen sich Intention und Wirkung, wird Klangrede zu einem, wie auch immer gearteten musikalischen Erlebnis transformiert. Selbstverständlich wäre es verkehrt, wollte man dabei Kopf und Bauch als Kriterien von Qualität gegeneinander ausspielen, denn ohnehin zeichnet es alle große Musik aus, daß kompositorisches Kalkül und Emotion im Einklang miteinander stehen, untrennbar zusammen gehören. Dies scheint mir aber in der vergeistigten Haltung Nonos wesentlich deutlicher der Fall zu sein als in der doch eher auf oberflächliche Wirkung hinzielenden Musik von Phil Glass: Glass vertraut auf das Vertraute. Nono hingegen sucht das Neue im Alten und kommt damit zu einer „Wirkung aus dem Geistigen”, die - wie Bernd Alois Zimmermann einmal sagte - „zutiefst in dem Erstaunen der Seele liegt, die das vernimmt, was sie zwar weiß und wußte, aber nicht zu benennen vermochte”.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
© 1994 Michael Denhoff
|