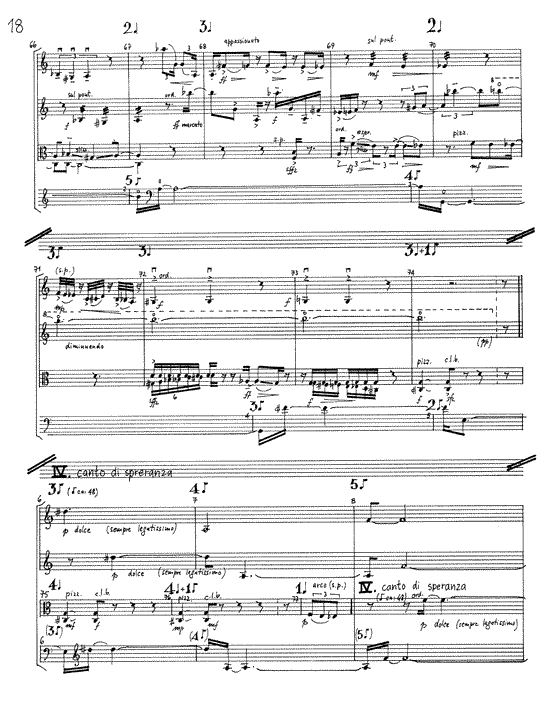|
Klaus Hinrich Stahmer KONSONANZEN – zum 8. Streichquartett von Michael Denhoff
„Nel interno“ [Im Inneren] nennt der 50-jährige Henze-Schüler Michael Denhoff sein vor zehn Jahren entstandenes 8. Streichquartett. Es ist ein ganz besonderes Werk: ein Werk der Vorahnung und zugleich ein Werk der Rück-Erinnerung. Man kann es nicht vermeiden, dieses Stück mit der Musik von Gustav Mahler zu vergleichen. Zugegeben, es sind zunächst nur Äußerlichkeiten, die diesen Vergleich nahe legen, aber es sind doch ganz eindeutige Bezüge, die uns einen Schlüssel zum Verständnis der Musik von Denhoff in die Hand geben: ich spreche von den Herden-Glocken, die am Ende des viersätzigen Werks aus dem Lautsprecher erklingen. Da tauchen gegen Ende des Finales die sphärenhaften Quartettklänge in ein Herden-Geläut ein, wie es schon Gustav Mahler in seiner 7. Sinfonie benutzt hatte, Schaf- und Ziegenglocken, die bei Mahler in der ersten von zwei „Nachtmusiken“ nach den eigenen Worten des Komponisten „weltfernste Einsamkeit“ symbolisieren; Klänge, wie sie „der auf einsamer Höhe Stehende erlauscht“, wenn er „ein ganz aus weiter Ferne verhallendes Herdengeräusch“ (G.M.) herüber tönen hört. – Ähnlich scheint mir die Bedeutung dieser Toneinspielung am Ende des Quartetts bei Denhoff zu sein. Doch während Mahler die Glocken live im Orchester besetzt, benutzt Denhoff elektronische Mittel. Aber wie anders klingt das, was bei Denhoff aus dem Lautsprecher tönt, als was bei Mahler auf der Bühne im Augenblick des Gehört-Werdens erzeugt wird. Dieser kleine Unterschied – live gegen Tonkonserve – bewirkt nämlich eine ästhetische Brechung der ansonsten zitathaft wirkenden Glockenklänge. Die kleine, unscheinbare Differenz lässt den aufmerksamen Zuhörer erkennen, dass das Gemeinte – ich könnte auch sagen: das Gewünschte – bei Denhoff noch weiter weg ist als bei Mahler.
Herdenglocken stehen ein für etwas Idyllisches. Bei Mahler wie auch bei Denhoff sind sie Symbol für etwas, das verloren ging. Fast ein wenig billig und blechern scheppern sie bei Denhoff aus dem Lautsprecher und verweisen zum einen auf Gustav Mahler und zum anderen auf Almwiesen, wo es – wie es in einem Lied heißt – „koa Sünd’“ [keine Sünde] gibt. Doch den Idealzustand gibt es nicht mehr, ja, der Traum kann nicht in Erfüllung gehen: Je (technisch gesehen) unvollkommener diese Glocken nun klingen, desto ehrlicher wird das Eingeständnis von der Unerreichbarkeit des „Verlorenen Paradieses“. Schon einmal hat ein Komponist dieselben Glocken im Sinne eines Zitats eingesetzt: Anton Webern. Nur fünf Jahre nach Mahler benutzte er sie reminiszenzartig in seinen Orchesterstücken op. 10. Und es kommt nicht von ungefähr, dass wir an dieser Stelle auch von Webern sprechen müssen. Denn dieser hochsensible Tonsetzer versteckte tief empfundene Regungen lieber hinter der Objektivität von handwerklich perfekt gemachten Fassaden, als dass er sich einem hemmungslos verströmenden Ausdruck hingegeben hätte. Auch Michael Denhoff hat etwas von dieser bescheidenen Zurücknahme des Allzu-Persönlichen, namentlich in diesem Werk, sagt er doch unter Verweis auf Ludwig Wittgenstein ausgerechnet über sein 8. Streichquartett: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“. Kein anderes seiner Stücke bleibt von ihm so unkommentiert wie gerade dieses Werk, so dass wir als Analytiker auf die eigene Spürnase angewiesen sind.
Obwohl nun bisher kaum über etwas anderes als eine (scheinbare) Nebensächlichkeit gesprochen wurde, die von CD eingespielten Herdenglocken, ist doch der bis zu diesem Punkt hergestellte Sinnzusammenhang schon recht aussagekräftig. Kommen wir jetzt zu den Tempobezeichnen, die uns weiteren Aufschluss geben. Denhoff nennt den in den Glocken-Klang übergehenden vierten Abschnitt „Canto di speranza“ [Gesang der Hoffnung]. Voran geht ihm ein mit „pesante e disperato“ [schwergewichtig und voller Verzweiflung] überschriebenes Adagio, das seinerseits heraus wächst aus dem zweiten Abschnitt: Presto misterioso ed eccitato [Geheimnisvoll und aufgeregt]. Ist das nun Programm-Musik? Ja und nein. Zumindest darf es als ein Prozess interpretiert und aufgeschlüsselt werden, der in seinem ersten Stadium in sphärenhaft schwebenden Konsonanzen noch in sich ruht und paradiesische Zustände zu beschreiben scheint. Von den Spielern sanft dazu angeschlagene Metallbecken verleihen diesem Streicherklang zusätzlich den Charakter des Unwirklichen. Hier trübt kein Schmutz das reine Wasser. Doch das Unheil naht in Form expressiver Gesten und kleiner Ausbrüche, die wie ein Vor-Beben zu verraten scheinen, wie es in Wahrheit im Innern aussieht. Immer erregter werden diese Melodiebögen, immer drängender, bis sie sich in das eccitato [erregt, aufgeregt] des Presto ergießen und der Vulkan ausbricht. Von hier ist dann der Weg in die Verzweiflung des dritten Abschnitts gewissermaßen zwingend vorgeschrieben, und spätestens an dieser Stelle müssen wir wieder von Mahler sprechen. Denhoffs Hammerschläge, dieses Hernieder-Fahren der Streicherfiguren, all das erinnert an manche selbstquälerische musikalische Verlautbarung von Gustav Mahler. Und wie Mahler um Erlösung ringt und diese dann in Form von Sätzen wie „Das himmlische Leben“ (4. Sinfonie) zeitweise auch findet, führt Denhoff seine Musik im vierten Satz zurück in den paradiesischen Zustand des Anfangs. Doch wie bereits gesagt: Was da aus dem Lautsprecher herüber klingt, weckt denn doch eher Zweifel als Hoffnung. „Paradise Lost“ scheint diese Musik zu sagen, die Denhoff in nur wenigen Tagen zu Papier brachte, und deren Spontaneität, mit der sie sich im Schöpfungsprozess verdichtete, ihn „zutiefst irritierte: Ich hatte das Gefühl, als führe eine fremde Hand die meinige, und dennoch ahnte und wusste ich, dass sich in diesem rauschhaften Schaffensdruck etwas entlud, das sich über einige Zeit angestaut hatte und das sich nur in Klang-Gestalt eruptiv freisetzen konnte, etwas nicht anders Benennbares.“ (M.D.) Denhoff selber zieht eine Parallele zu seinem bisher „wohl gewichtigsten und persönlichsten“ Kammermusikwerk, dem zwei Jahre später entstandenen Klavierquintett op. 83 und empfindet dieses vergleichsweise miniaturhafte Streichquartett als „eine Art Vor-Echo“ zu dem gigantischen Nachfolgewerk, dessen Aufführung nicht weniger als zweieinhalb Stunden erfordert.
Es ist im Zusammenhang des heutigen Abends unerlässlich, über einen Begriff zu sprechen, der wesentlich zur Sinngebung des 8. Streichquartetts von Denhoff beiträgt: Die Konsonanz. Wohl selten überlässt sich ein Tonsetzer unserer Tage so nachdrücklich und ungebremst dem Sog der Konsonanz, wie Denhoff zu Beginn und zu Schluss von „nel interno“. Reine Dreiklänge scheinen ihm so etwas wie den Zustand des Paradiesischen zu verkörpern. Lassen Sie mich, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ein wenig bei diesem Punkt verweilen und auf ein Paradoxon aufmerksam machen: Heute verstören solche reinen Klänge den dissonanz-geübten Zuhörer der modernen Musik mindestens ebenso, wie zu Mozarts Zeiten die geballt auftretenden Dissonanzen den konsonanz-gewohnten Zuhörer verschreckt haben, so dass einer von ihnen das C-Dur-Quartett KV 465 schlichtweg als „Dissonanzen-Quartett“ betitelte.
© 2006 Klaus Hinrich Stahmer
8. Streichquartett „nel interno“ – Übergang vom 3. zum 4. Satz
Anmerkung: Der Text ist ein Auszug aus einem Vortrag, den Klaus Hinrich Stahmer bei der Auftakt-Veranstaltung zum deutsch-polnischen Projekt „Klangbrücke“ am 9. November 2006 in der Aula Leopoldina in Breslau hielt. Der Vortrag unter dem Titel „Assonanzen – Konsonanzen – Dissonanzen“ führte ein in ein Konzert mit dem Ludwig Quartett Bonn, das Werke von Bialas, Denhoff und Mozart aufführte. Der Text wird hier mit freundlicher Erlaubnis des Autors im Internet veröffentlicht.
|