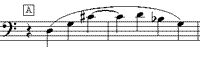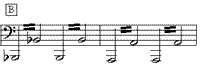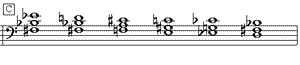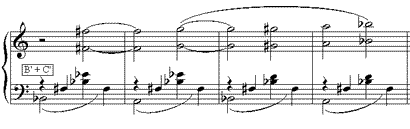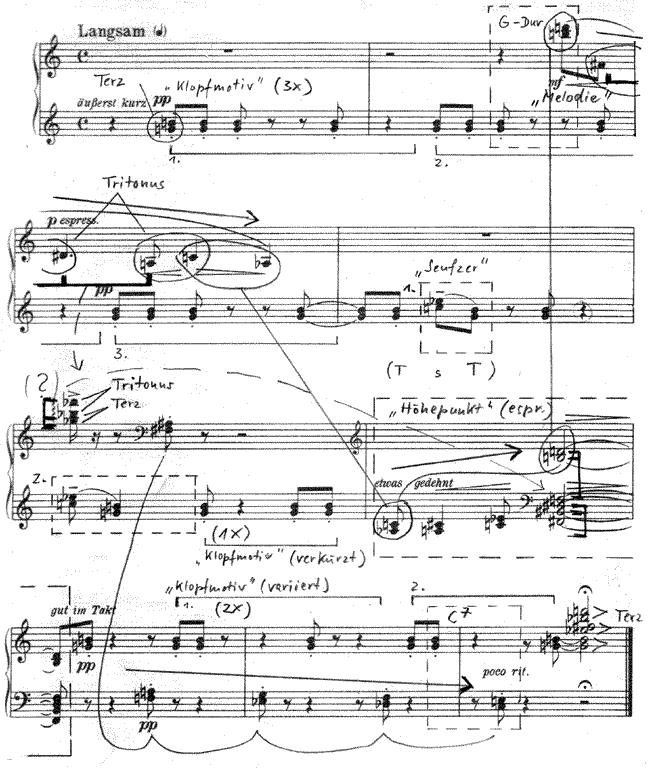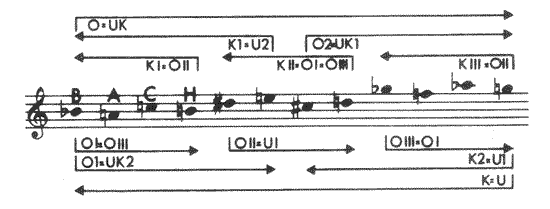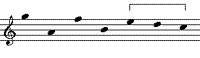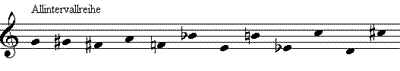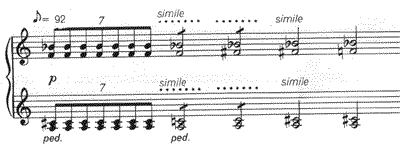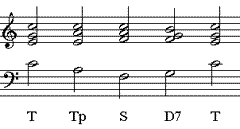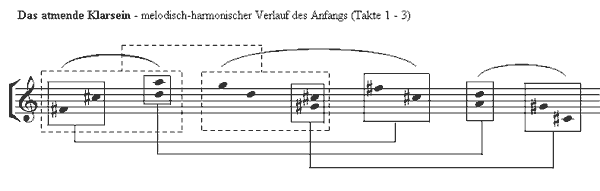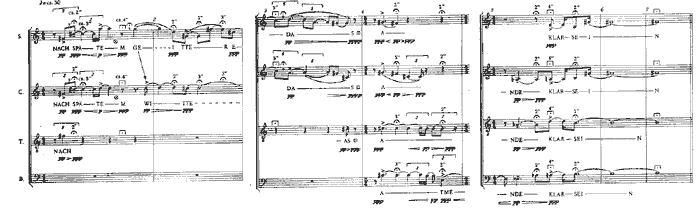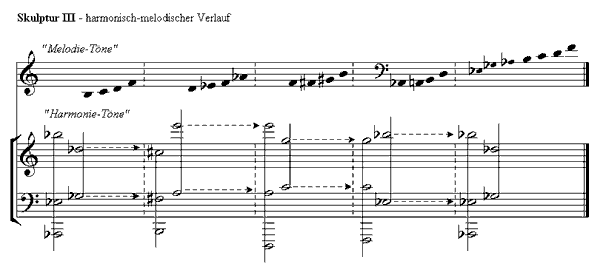DER KLEINE UNTERSCHIED
Komponieren mit wenig Material
Vortrag am 14. 2. 2004 in Würzburg
beim Workshop-Tag „reduziert – komponiert“ im St. Burkardus-Haus
|
I. Auftakt
Wir haben soeben zum Auftakt unseres heutigen Workshop-Tages zwei Klavierstücke gehört, deren spröde Klanglichkeit man kaum einem Franz Liszt zuschreiben möchte, passen sie doch so gar nicht in das Bild, welches wir allgemein mit dem Namen Liszt verbinden. Franz Liszts späte Klavierstücke sind eine Entdeckung unserer Zeit. Daß sie den mephistophelischen Abbé als einen der Väter der Musik des 20. Jahrhunderts ausweisen, war einigen Kennern zwar bereits aufgefallen, daß man diese Stücke aber nicht nur lesen, sondern auch spielen und einem hörenden Publikum vermitteln kann, wurde erst mit fast hundertjähriger Verspätung entdeckt. Mit ihnen gerät das Bild des Tastenlöwen ins Wanken: nicht mehr der Rausch der Virtuosität und der Salon-Prunk des 19. Jahrhunderts bestimmen diese Werke, sondern radikale Einfachheit gepaart mit der Auflösung der Dur-Moll-Tonalität. Die Melodik verzichtet auf herkömmliche Vorstellungen des Gesanglichen. Einsame Möglichkeiten der Einstimmigkeit werden erprobt. Der Rhythmus ist obsessiv und bohrend, die Klangfarben vorwiegend dunkel und grell, fahl und ätherisch. Zudem fällt auf, daß hier mit nur ganz wenigen kompositorischen „Bausteinen“ gearbeitet wird und dabei der genutzte Ton- und Intervall-Vorrat zudem äußerst sparsam ist.
Und damit sind wir schon bei dem angekommen, was Thema dieses Vortrages ist: das Komponieren mit wenig Material. Daß es dabei eine große Fülle an Möglichkeiten gibt, daß Reduktion der Mittel nicht zwangsläufig ein Verlust an klingendem Reichtum bedeuten muß, daß aber auch umgekehrt Konzentration auf nur Weniges nicht automatisch Verdichtung eines geistigen Entwurfs bedeutet, das möchte ich anhand ausgewählter Beispiele der Musik der letzten rund 100 Jahre zeigen. Ich werde mich dabei im Wesentlichen auf die westeuropäische Musik beschränken, auch wenn Kenner der zeitgenössischen Musik beim Wort Reduktion sicherlich schnell die Musikrichtung assoziieren, die in den siebziger Jahren des nun schon vergangenen Jahrhunderts aus Amerika kommend mit dem Begriff „Minimal music“ etikettiert wurde. Die amerikanischen Ausprägungen der Aspekte einfacherer kompositorischer Strukturen dürfen bei unserem Thema selbstverständlich nicht außer Acht gelassen werden, zumal sie einen nicht wegzudiskutierenden Einfluß auf die sogenannte Neue Musik in Europa hatten, ja - wenn man so will - sogar eine schockhafte und auch befreiende Wirkung auf die zu erstarren drohende „Darmstädter Ästhetik“ einer komplexen und strukturalistischen Überfrachtung. Und so werde ich, wo zum Verständnis nötig, auch amerikanische Komponisten erwähnen. Umfassender wird Ihnen heute Nachmittag Martin Erdmann die verschiedensten Verästelungen der Ästhetik einer Musik erläutern, die sich in bewußter Abkehr zur abendländischen Tradition in Amerika entwickelte.
Doch kehren wir zunächst noch einmal zu Liszts späten Klavierstücken zurück. Das beunruhigend Düstere in Nuages gris entsteht zu Beginn durch die ziellose Richtung der in sich kreisenden monologisierenden Melodie (A), die geradezu fragend einen fallenden g-moll Dreiklang ansteuert, durch das unheimliche Tremolo im tiefen Baßbereich (B) und durch die chromatisch gerückten übermäßigen Dreiklänge (C), denen jede funktionale Erdung fehlt. Erst die chromatisch aufsteigende und entschwebende Linie über eine pendelnde Begleitfigur, die harmonisch vom Tremolo und den übermäßigen Dreiklängen abgeleitet ist (B’ + C’), löst diese Spannung und mündet in zwei helle offene Klänge, die entrückend das Stück beenden.
Als eine Art Paraphrase über Nuages gris komponierte Mauricio Kagel 1972 als Teil seiner Kammermusikreihe Programm ein Stück mit dem Titel Unguis incarnatus est für Klavier und… (mit den drei Pünktchen ist ein tiefes Melodieinstrument gemeint, beispielsweise ein Violoncello). Kagel überhöht den beunruhigend ziellosen Charakter des Stückes in seiner Paraphrase dadurch, daß er das Brüchige des Materials mit dessen eigenen Mitteln weitertreibt und es zersetzt: die melodischen Phrasen lösen sich rotierend in ihre Bestandteile auf, die übermäßigen Dreiklänge werden in Vereinzelung gedehnt oder in stotterndes Repetieren versetzt, das Tremolo erscheint nur noch irregulär und wird durch beklemmende Klopfgeräusche ergänzt, die der Pianist mit dem Treten des Pedals erzeugt. All das kulminiert am Ende in einem lauten Schrei beider Musiker, die damit dem Spuk ein Ende setzen. Hören wir also nun noch einmal das Lisztsche Klavierstück, diesmal durch die kompositorische Brille eines Mauricio Kagel:
Klangbeispiel Unguis incarnatus est (M. Kagel)
Trotz der Beschränkung auf nur ganz wenige Elemente wird hier sehr differenziert, und dabei im gestalterischen Verlauf für den Hörer nicht vorhersehbar (bzw. vor-hörbar) mit dem Material gearbeitet, sodaß eine ungeheure Spannung erzeugt wird. Diese entsteht auch dadurch, daß das schon Exponierte zwar immer wiederkehrt, dabei aber stets einer graduellen Veränderung ausgesetzt ist.
Bedenkt man die Entstehungszeit von Nuages gris – Liszt komponierte das Stück 1881 – so mag diese radikale Einfachheit wie ein „Stachel“ in der klangüberbordenden Spätromantik wirken, wie eine Flaschenpost in eine ferne Zukunft, die erst nach der endgültigen Abkehr von der funktionalen Tonalität fähig wurde, umfassender einzulösen, was hier schon vorgedacht erscheint. Die besondere Bedeutung gerade dieses kleinen Klavierstückes für heutiges Komponieren wird auch dadurch bestätigt, daß es neben Kagels reflektierender Paraphrase noch eine andere bemerkenswerte kompositorische Auseinandersetzung mit ihm gibt: Heinz Holliger bearbeitete 1986 die beiden heute schon gehörten Klavierstücke von Liszt für großes Orchester. Seine Transkription ist aber weit mehr als eine Übersetzung von zwei Klavierstücken in das größere Format von Orchesterfarben; wie in einer Übermalung wird das Visionäre in ein traum- und trancehaftes Klangbild ganz eigenen Zuschnitts gesetzt, welches das Original nur noch als Folie nutzt. (Übrigens habe ich im Liszt-Jahr 1986 auch genau diese beiden Stücke – und noch ein drittes – für kleines Orchester bearbeitet. Von Holligers Transkription wußte und konnte ich zu dem Zeitpunkt nichts wissen. Bei meiner Bearbeitung ließ ich mich von der fiktiven Vorstellung leiten, ein spätes dreisätziges Orchesterstück von Liszt zu rekonstruieren, von dem nur noch Klaviertranskriptionen aus seiner Hand existieren.)
Es stellt sich die Frage, was mag Liszt dazu geführt haben, in seinen letzten Lebensjahren solch ausgedünnte Texturen zu entwerfen, die zudem noch die herkömmliche Tonalität auszuhebeln scheinen, lange bevor mit Debussy und Schönberg der Weg in die freie Tonalität gegangen wurde? Darüber kann man nur spekulieren. War es die Erschöpfung an der großen Form und den gängigen Floskeln von Virtuosität? Oder war es ein visionäres Vorausschauen?
II. Außenseiter
Wenn ein Komponist sein Handwerk nicht nur nutzt, um sein Können anhand komplexer Strukturen zu demonstrieren, und das in virtuosem Umgang mit den Möglichkeiten seines Instrumentariums, wenn er sich also beschränkt, dann geht es ihm um Konzentration und Verdichtung. Ich glaube, dies gilt ganz allgemein – eben auch für heutiges Komponieren. Oder es geht ihm – und dafür gäbe es auch Beispiele – in dieser Beschränkung um Opposition, um einen bewußten Gegenentwurf zum allgemein Gängigen.
Erik Satie wäre dafür ein beredtes Beispiel. Auch er experimentierte – wie Liszt in seinen späten Klavierstücken – schon früh mit Akkorden und Klängen, die nicht mehr funktional verwandt waren. Und die Einfachheit, ja scheinbare Banalität seiner Melodien über quasi ostinate Begleitungen trügt nicht: sie ist so gemeint! Diese Einfachheit und Beschränkung hat aber gleichzeitig auch etwas sehr Eindringliches, und sie kann, wie beispielsweise in Vexations, dem 840mal zu wiederholenden kurzen Klavierstück, durchaus magische und mystische Wirkung erzielen. Mit kreativer Unerschrockenheit widersetzen sich seine vielen Klavierminiaturen dem, was zu der Zeit eigentlich angesagt war. Rollo Myers, der die erste ernstzunehmende Studie über Satie verfaßte, schrieb über das bis heute wohl populärste Klavierstück Trois Gymnopédies aus dem Jahr 1888: „In dem Wirrwarr so überladener, komplexer Klanggebilde, denen man sich Ende des 19.Jahrhunderts so begierig verschrieben hatte, wo war da der Platz für so etwas Zartes, Durchsichtiges wie diese bescheidenen Gymnopédies, deren reine Kadenzen an die barfüßig dargestellten Tänzer auf griechischen Vasen denken lassen?“ Gepaart ist diese Schlichtheit bei Satie meist mit subtil Hintersinnigem. Er war ein sein Publikum absichtlich hinters Licht führender Humorist. Dies betrifft die Werktitel wie auch die zahllos in seinen Partituren anzufindenden verbalen Beigaben, die mit ihren musikalischen Symbolen wenig oder keine Beziehung aufweisen zu dem, was klingt. Sie lesen sich wie poetische, manchmal auch abstruse Regieanweisungen an den ausführenden Musiker, die ihn durchaus irritieren können … und sollen! Da können bei sich identisch wiederholenden Figuren völlig sich widersprechende Anweisungen stehen. Die seltsame Dialektik zwischen identischem Notentext und veränderter Spielanweisung wird den Musiker zumindest dazu verleiten, das Gleiche eben nicht gleich zu spielen. Dieser feine Unterschied macht den Reiz jeder gelungenen Satie-Interpretation aus. Aber eben auch die so beiläufig im Notentext komponierten Veränderungen und Varianten schaffen trotz der äußerlichen Einfachheit eine feine Poetik im Detail. Analysiert man in Vexations ein wenig genauer die beiden jeweils 13 Viertelschläge langen Sektionen über die gleiche Baßlinie, so fällt auf, daß dort fast ausschließlich verminderte Dreiklänge verwendet werden. Der verminderte Dreiklang – in der spätromantischen Musik allgegenwärtig als harmonisches Scharnier für Modulationen und Chromatik – verliert hier aber die funktionale Bindung, er wird harmonisch offene Farbe – und damit eine „Karikatur“ seiner selbst. Es gibt jeweils einen übermäßigen Akkord auf dem zweiten Schlag und später noch zwei übermäßige Sextakkorde, aber auch diese ohne weiterleitende Funktion und Bedeutung. Die rhythmische Gestalt ist denkbar schlicht: nur Viertel- und Achtelwerte. Aber es sind keine zusammenhängenden Gruppen zu finden, die sich als Modell wiederholen. All dies läßt die Klänge, die in der zweiten Sektion bei gleichem Baß nur in der Lage umgestellt sind, scheinbar heimatlos weiterschreiten. Ziellos folgt ein Klang dem anderen. Oder anders gelesen und gehört: es klingt wie ein unvollständiger und ungelenk gesetzter homophoner Choralsatz …
Es ist diese (auch ironische) Brechung, das Vexierspiel des Vertrauten im Fremden, die das kurze und doch so lange Stück unterscheidet von tatsächlich Banalem. Daß es nicht simpel gemeint ist und die Einfachheit eine nur scheinbare ist, läßt sich auch an der „verqueren“ Notation ablesen: die diversen Akzidenzien (z. B. ein Bes gefolgt von einem Ais) verhindern ein flüssiges Lesen und zwingen den Interpreten – möglicherweise beabsichtigt – zum langsamen Spiel. (Etwas Ähnliches ist übrigens auch in den langen Stücken von Morton Feldman wiederzufinden.) Es mag nicht verwundern, daß es John Cage war, der eine erste Aufführung von Vexations initiierte, die 1963 stattfand und 18 Stunden dauerte. Cage wie Satie waren Außenseiter, die traditionelle Vorstellungen von Musik mit ihren Werken und Texten in Frage stellten. Ihre „Späße“ (nennen wir in diesem Zusammenhang ruhig auch einmal 4’ 33“ von Cage) haben durchaus ernsthafte Untertöne. Cage fühlte eine besondere Affinität zu Satie, und in Silence, seinem Buch mit Lesung über das Nichts und die Stille wird dies bestätigt: es enthält auch ein imaginäres Gespräch zwischen ihm und Satie.
Wird Reduktion der kompositorischen Mittel auf die Spitze getrieben, ist die Stille, das Schweigen und damit der Weg zu einem Stück wie 4’ 33“ die logische und zwingende Konsequenz. Die absolute Stille aber gibt es nicht, wie wir wissen. Selbst in einem schalltoten Raum hören wir: … nämlich unseren Körper. Es ist Cages Verdienst, bewußt gemacht zu haben, daß das Nicht-vorhanden-Sein von Klängen doch auch Klingen bedeutet. Er selbst hielt übrigens, wie er immer wieder betonte, dieses stille Stück für sein bestes; – auch wenn im Grunde genommen jeder andere es hätte „schreiben“ können. Cages Einfluß auf die Neue Musik ist unbestreitbar und unüberhörbar. Wie aber bei allen ungewöhnlichen Erscheinungen in der Kunst ist das Missverständnis und Epigonale nicht weit. Dies bezieht sich nicht nur auf jenes „berühmte“ Stück, sondern ganz grundsätzlich auf Cage, der von den Einen wie ein Guru verehrt wird und von Anderen als Scharlatan abgetan und abgelehnt wird. Daran hat sich bis heute – immerhin gut 10 Jahre nach seinem Tod – nichts geändert.
Ich möchte Ihnen ein Stück anspielen, welches 1992 entstanden ist und sich selbst als eine Hommage an Cage versteht. Der holländische, in Deutschland lebende Komponist Antoine Beuger (Jahrgang 1955) ist Mitbegründer des Wandelweiser Komponisten-Ensembles, einer Initiative, die ganz explizit die Realisierung neuartiger Konzepte der experimentellen Avantgarde im geistigen Umfeld von John Cage oder auch Christian Wolff betreibt. Sein Akkordeonstück die geschichte des sandkorns schrieb er für das Konzertprojekt „A birthday Dinner for John Cage“, das 1992 im Düsseldorfer Stadtmuseum stattfand. In diesem gut eine Stunde dauernden Stück ereignet sich fast nichts. Vereinzelte Töne, sehr lange und sehr kurze, durchsetzt mit Luftgeräuschen durch Ziehen des Akkordeonbalges und Tastenklappern, sie sind das spartanisch anmutende Material, welches wie zufällig die langen Pausen der Stille unterbricht, sie somit gleichzeitig gliedert und zersetzt. Eine kompositorische Ordnung, welcher Art auch immer, ist selbst bei konzentriertestem Lauschen nicht auszumachen, und soll es auch wohl nicht. Vermutlich würden Sie in den 4 Minuten und 33 Sekunden des „stillen Stückes“ von Cage mehr „hören“, als Sie hier in über einer Stunde „zu hören bekommen“ … aber hören und urteilen Sie selbst (auch wenn ich nur einen Ausschnitt vorspielen kann) …
Klangbeispiel die geschichte des sandkorns (A. Beuger)
III. Auf zu neuen Ufern …
Machen wir nun noch einmal einen großen Zeitsprung zurück an den Anfang des 20. Jahrhunderts. Mit dem „Aufbruch zu neuen Ufern“, der durch Arnold Schönberg und seinem Schülerkreis um 1910 herum stattfand, ging es nicht in erster Linie um das Erreichen eines Zieles, sondern vielmehr um einen geistesgeschichtlichen und kulturellen Neuanfang. Dies war eine allgemeine Bewegung, die alle Kunstsparten betraf. Die Aufbruchstimmung führte in der Musik zur Suche nach neuen Tonsystemen und auch die überlieferten Formschemata konnten nicht mehr kritiklos als Hülse übernommen werden, sie mußten dem Wandel der Tonsprache Rechnung tragen. Natürlich geschah dies nicht nur eingleisig im Kreis um Schönberg, denn auch in Osteuropa gab es wichtige Strömungen. Daß der große Teil der nur wenig jüngeren Komponistengeneration, die an die von Schönberg beschrittene Ablösung von der Romantik anknüpften, hier einen Ausgangspunkt sahen, erklärt sich auch in der neuen, stark versachlichten geistigen Haltung im Verhältnis zum Kunstwerk, und ist durchaus als Reaktion auf die Überfrachtung, die semantische Überfütterung des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu verstehen. Aber nicht nur die Dodekaphonie, die als Konsequenz lediglich eine Systematisierung der freien Tonalität ist und die in den 50er Jahren in die unheilvolle Sackgasse der seriellen Musik führte, sondern auch die Einbeziehung folkloristischer Elemente und ihres rhythmischen Kolorits, etwa bei Strawinsky und Bartók, bot eine tragfähige Möglichkeit hin zu einer Entwicklung einer neuen Tonsprache. In allen Fällen brachte die In-Frage-Stellung des Dur-Moll-Systems und die damit einhergehende Ablösung des Formbegriffs es mit sich, daß es keine fest verfügbaren und wiederholbaren Großformen mehr gab. Form durchbrechend mußten neue Formen und Gestalten gefunden werden, mit jedem Werk der Werkbegriff neu definiert werden. Mit dem Tasten in die freie Tonalität konnten nicht gleich neue Großformen entstehen. Nun bekam jeder Einzelton sein besonderes Gewicht dadurch, daß er sich aus sich selbst heraus rechtfertigen mußte. Die musikalische Miniatur ist also nicht nur der musikgeschichtliche Pendelschlag vom Riesigen in sein Gegenteil, sondern die zwingende Notwendigkeit, im kleinen Detail abzuwägen und eine neue Logik der musikalischen Rede auszuprobieren.
Sicherlich gehören die Sechs kleinen Klavierstücke op. 19 von Arnold Schönberg aus dem Jahre 1911 zum Besten, was die Musikgeschichte an Miniaturen zu bieten hat. Lassen Sie mich anhand des zweiten Stückes aus dieser Folge einmal beispielhaft zeigen, wie einerseits mit ganz wenigen Tönen komponiert wird, wie überliefertes kompositorisches Denken dabei aber unterirdisch doch weiter mitschwingt und gleichzeitig etwas ganz Neues und trotz der Reduktion nichts Beiläufiges entsteht.
Zentrales Intervall des gerade einmal neun Takte umfassenden und nur etwa eine Minute dauernden Stückes ist die Terz, das konstitutive Intervall funktionaler Harmonik. Das Stück beginnt mit einem „Klopfmotiv“ aus der Großterz G-H in der linken Hand, welches sich taktweise dreimal wiederholt. Es stellt sich ein G-Dur Gefühl ein. Darüber erhebt sich, auftaktig zum dritten Takt, eine kleine Melodie, die mit ihrer ersten Terz H-D das G-Dur Gefühl zu bestätigen scheint, die aber gleich mit ihrem Fortgang unter den Tonraum des „Klopfmotivs“ springt, dabei den Zusammenklang der einsetzenden Kleinterz linear aufblättert und abwärts gerichtet in Kleinterzen weiterführt. Im Zusammenklang von Melodie und Begleitung ist das G-Dur Gefühl ausgelöscht. Der letzte Melodieton bildet zum vorherigen wieder eine große Terz. Genau an diesem Punkt bleibt der letzte Schlag des „Klopfmotivs“ verharrend liegen und es erwächst aus ihm ein kleines „Seufzermotiv“, das wie ein „Echo“ des ersten Melodieauftaktes wirkt. Durch die Kleinterz C-Es wird diese Geste wie ein kurzer Schwenk in die Mollsubdominante empfunden. Diese „Seufzergeste“ wiederholt sich gedehnt, hinzukommt erstmals ein kurzer arpeggierter Dreiklang in der rechten Hand, aus Großterz und Tritonus gebaut. Dieser überraschende Klang ist aber versteckt schon vorbereitet gewesen: in der ersten Melodielinie, die den Tritonus zu Beginn des dritten Taktes als Intervall einführt. Dem Arpeggio-Akkord folgt die „Klopfterz“ nun in der rechten Hand, aber eine kleine None unterhalb der Ausgangsterz G-H, die in der linken Hand noch einmal kurz antwortet. Ihr Kopf-Rhythmus (zwei Achtel) wird aber nun Auftakt zu einer kurzen und in Terzen aufsteigenden Linie mit durchaus expressivem, ja spätromantischem Charakter. Dabei ist die erste Terz As-C der Zusammenklang der beiden letzten Melodietöne vom Anfang (Takt 3) und die letzte Terz H-D wieder der Beginn der ersten Melodie (Takt 2). Diese Terzenlinie ist somit quasi rückläufig auf sie bezogen, als Variante von ihr abgeleitet. Unter die endende Terz H-D wird nun ein Viertonklang gelegt, der wiederum aus einem Tritonus und einer Terz gebaut ist. Sein oberster Randton F bildet zur Linienterz H-D ebenfalls einen Tritonus: der zusammenklingende 6-Ton-Klang ist also genauso genommen die Addition der Töne 3, 4 und 5 der Anfangsmelodie, zweifach im großen Septabstand, und damit gleichzeitig auch mit dem kurzen Arpeggio-Klang in Takt 5 verwandt. Es folgt nach diesem inneren „Höhepunkt“ wieder zweimal das „Klopfmotiv“, nun in der rechten Hand und in seiner rhythmischen Gestalt variiert: es sind abwechselnd nur noch zwei und ein Schlag (am Anfang waren es drei und ein Schlag), gleichzeitig sind die Pausenwerte vergrößert. Darunter fällt in vier Schritten und in einer Scala absteigend eine ebenfalls staccato gespielte Terzenfolge auf die abschließende Terz C-E, die das Ohr nun mit der Klopfmotivterz G-H zu einen abschließenden C-Dur-Septakkord addiert. Diese kurze Wirkung wird aber sofort durch den Schlussklang aus drei geschichteten Terzen wieder ausgelöscht ins harmonisch Offene. Die vier fallenden Terz-Staccati erinnern zum einen – nun in Gegenrichtung – an die kurze aufsteigende Espressivo-Geste in Takt 6, sie knüpfen zudem an die Terz auf dem zweiten Viertel in Takt 5 an, und sie sind gleichzeitig die Verschmelzung von „Melodie“-Linie und „Klopfterz“. Man könnte noch weitere interessante Aspekte dieses Stückes unter die Lupe nehmen, so z. B. die diversen formalen Proportionen zueinander, die dem „Goldenen Schnitt“ nahezu entsprechen. Aber auch schon so werden Sie bemerkt haben, wie alles aufeinander bezogen und voneinander abgeleitet ist, wie höchst artifiziell bis ins kleinste Detail gedacht wurde, und das mit so wenig Material. Formal könnte man eine freie ABA-Form assoziieren, oder sogar auch eine auf kleinsten Raum kondensierte Sonatenform. Und doch ist diese Miniatur natürlich etwas Anderes, etwas wirklich Neues zu ihrer Zeit. Dies gilt für alle sechs Stücke dieses kleinen Zyklus’. Es ist eine sich frei entfaltende Musik, und doch ist sie aus ihren eigenen Setzungen heraus in sich zwingend.
Während Schönberg bei seinem ersten dodekaphonischen Stück, der Klaviersuite op. 25 (1925) paradoxerweise auf barocke Tanzformen zurückgreift, so, als traue er dem neuen Vokabular eine eigene neue Form nicht zu, geht Anton Webern diesen entscheidenden Schritt zu neuen Formen. Ohnehin ein Komponist von Werken stets kurzer Dauer und sparsamer Mittel, gelingt es ihm, aus der Reihentechnik abgeleitete Form-Modelle zu finden. Und schon allein die den streng zwölf-tönigen Werken zugrunde liegenden Reihen sind kleine Meisterwerke von bezwingender innerer Logik. Ich möchte hierfür nur die Reihe des Streichquartetts op. 28 aus dem Jahr 1938 erwähnen:
In dieser Reihe sind Original und Krebsumkehrung sowie Umkehrung und Krebs identisch, alle vier Grundformen decken sich also in der Intervallfolge dieser Reihe. Gleiches gilt zudem, wenn man die Reihe in zwei Sechston-Gruppen oder auch in drei Vierton-Gruppen teilt. Genaugenommen besteht diese Reihe ja sogar nur aus den vier Tönen des B-A-C-H-Motivs! Damit ist der aus dieser Reihe ableitbare melodische Radius extrem eingegrenzt. Wie ein fein geschliffenes Kristall von irritierender Schönheit und Fremdheit wirkt der erste Satz des Quartetts, dessen rhythmische Gestalt ganz schlicht ist und fast archaisch anmutet.
Klangbeispiel Streichquartett op. 28, 1. Satz (A. Webern)
Dieses Höchstmaß an Konzentration und Vergeistigung zu finden, ist nur wenigen Komponisten gegönnt. Einer von Ihnen ist der ungarische Komponist György Kurtág. Sein bisheriges Gesamtoeuvre ist wie das von Webern sehr überschaubar, und wie Webern ist auch er ein Meister in der verdichteten Kleinform. Das wohl kürzeste Stück aus seiner Feder findet sich in dem work in progress Jatékók, einer Sammlung von kurzen Klavierstücken, die mittlerweile auf sieben Bände angewachsen ist und auch wie ein Arbeitsbuch zu verstehen ist, denn viele andere Werke von ihm haben ihre ursprünglichen Wurzeln hier (so z. B. auch die beiden heuteabend erklingenden Quartettsätze Aus der Ferne III + V). Blumen die Menschen … (sich umschlingende Töne), so der Titel dieses Stückes, das aus nur sieben Tönen besteht die von drei Händen an einem Klavier auszuführen sind. Die sieben Töne dieses Blumenstückes sind die weißen Tasten der diatonischen Tonleiter.
Staucht man diese Töne auf engen Raum, so ergeben sich zwei mögliche trichterförmige Gestalten, die an einen Blütenkelch erinnern. Diese Tonfolge scheint eine ganz schlichte Variante der oft genutzten, schnabelförmigen Allintervallreihe zu sein. Nach deren Gesetz müssten aber eigentlich die beiden letzten Töne der Kurtág-Reihe vertauscht sein. Diese kleine aber feine Abweichung erzielt dezent eine kadenzierende Schlußwendung nach C, die allerdings in Kurtágs Setzung in extrem weiter Lage nur noch wie aus weitester Erinnerung aufscheint.
Kurtág selbst hält dieses kleine Stück für eines seiner wichtigsten und gelungensten. Ähnlich wie Cages 4’ 33“ ist es auf seine Art ein ganz außergewöhnliches Stück! Auch gerade deswegen, weil es auf den ersten Blick so simpel zu sein scheint, so, daß man fast denken möchte, es hätte jedem Komponisten einfallen können… Es gibt übrigens auch eine denkwürdige, aber sicherlich nur zufällige Verwandtschaft zu dem Stück von Schönberg, welches ich eben etwas detaillierter analysiert habe: es ist der „tonale Weg“ von G nach C. Peter Eötvös schrieb über dieses Stück: „Die musikalische Gestalt, die schon aus den wenigen Tönen entsteht, vermittelt etwas Umfassendes. In ihrer Ganzheit strahlt sie große Ruhe aus, und doch ist auch Bewegung und Entwicklung darin: zwei Töne, in einem fallende Bogen verbunden, bilden ein Motiv, ein größerer dreitöniger Bogen gibt Antwort darauf. Der dritte Bogen schließt als Coda wieder mit zwei Tönen ab und öffnet gleichzeitig einen noch größeren Klangraum.“ Es ist immer wieder bewegend (ich hatte dazu mehrfach die Gelegenheit), Márta und György Kurtág auf der Bühne zu sehen, wenn sie – meist zu Beginn eines Konzertes – diese sieben Töne spielen. Mit sich überkreuzenden Armen und Händen, sich gegenseitig umschlingend, werden beide selbst diese Töne, die sie da spielen, und sie zeichnen mit ihren Gesten am Klavier die Bögen, die die Töne verbinden.
Klangbeispiel Blumen die Menschen … (sich umschlingende Töne) (G. Kurtág)
IV. Der Weg nach Innen
Die zunehmende Komplizierung und Materialanhäufung in der Neuen Musik nach dem 2. Weltkrieg implodierte in den 70er Jahren. Mit der damals aus Amerika herüberschwappenden Welle der sogenannten „Minimal Music“ (ich erwähne hier nur als spektakulärstes Beispiel Drumming von Steve Reich aus dem Jahr 1971) begann sich ein „Virus“ auszubreiten, der auch altgestandene Avantgardisten infizierte: so bezieht sich z. B. das mittlere Stück der Drei Stücke für zwei Klaviere (1976) von G. Ligeti explizit auf Steve Reich und Terry Riley. Nun wurde auch der normale Dreiklang - lange als verstaubt verpönt - wieder hoffähig. In diesem Zusammenhang ist auch an die Diskussion um die „Neue Einfachheit” zu erinnern, die - als durchaus fragwürdiges Etikett - sich eher als eine journalistische Seifenblase denn als haltbare Definition kompositorischer Befindlichkeit entpuppte. Dennoch umriss diese Formel bedingt ein Phänomen der sich wandelnden Komponiertendenzen: die Abkehr von der rein intellektuellen Legitimation kompositorischen Handelns. Unter Vorgabe einer allgemeineren Verständlichkeit lichteten sich die Partituren wieder zu faßlicheren und vertrauteren Strukturen; man wollte aus dem engen Zirkel der Insider-Veranstaltungen ausbrechen und auch wieder beim normalen Abonnementspublikum Gehör finden. Eher eine Ausnahme und mehr Randerscheinung blieben dabei Streichquartette in D-Dur im Stil des ausgehenden 18. Jahrhundert wie bei L. Kupkovic oder der schumanneske Romanzen-Tonfall in den neueren Stücken von W, Killmayer. Das vermehrte Auftauchen von traditionellen Versatzstücken in den neueren Partituren rechtfertigte jedoch scheinbar den aus der Architektur entlehnten Begriff „Postmoderne“, der nun als „Terminus technicus“ für das Auftauchen einer eher rückwärts gewandten Komponierhaltung wurde. Ich will hier nicht auf die grundsätzliche Problematik eingehen, die mit diesem Begriff in der Diskussion mehr Verwirrung denn Klärung geschaffen hat. Aber so verschieden die divergierenden Strömungen seit 1970 auch gewesen sein mögen, so auffällig war doch die Veränderung, die sich schon an der Wahl der Titel artikulierte; es wurden wieder Konzerte, Sinfonien, Opern und Streichquartette komponiert und die Stücke hießen nicht mehr Structures oder Kreuzspiel, sondern Traumformel und Rituel.
Spektakulärstes Beispiel für den Erfolg tendenziell rückwärtsgewandten Komponierens ist die 3. Sinfonie („Sinfonie der Klagelieder“) von Henryk Gorécki. Diese schon 1976 entstandene Sinfonie erlebte Anfang der 90er Jahre eine kometenhaft aufsteigende Popularität, sie stürmte die Klassik-Charts und die Verkaufszahlen der Neueinspielung erreichten eine Größenordnung, wie sie sonst nur im Pop-Bereich bekannt waren. Wie war dieser plötzliche Erfolg zu erklären? Es scheint wohl ein latentes Bedürfnis an eben dieser Art von Musik bestanden zu haben (und auch heute noch zu bestehen), und das resultierte möglicherweise aus der akustischen Reizüberflutung, die uns tagtäglich umgibt und die mehr auf nervöse Stimulierung denn auf Beruhigung setzt. Diese Musik konnte offensichtlich die beschleunigte Zeit mit ihrer einfachen und faßlichen, ja eben auch vertrauten Gestalt beim Zuhörer entschleunigen: drei groß dimensionierte langsame Sätze von fast kaum unterscheidbarem Charakter, eine archaisch anmutende Strenge, kein orchestraler Farbenreichtum, fehlende Kontraste, nur sich schichtende Streicherlinien zu einem unendlichen Fließen und dazu eine Sopran-Stimme. Solch eine extreme Meditations-Musik zog natürlich auch den Spott auf sich: von "Orchestraler Breitwand-Tristesse für Techno-Kids", einem "Ohrwurm auf der Kriechspur" und "Balsamierter Partitur" war da die Rede. Mit den Mitteln musikalischer Analyse kann man dieser Musik wohl nicht gerecht werden, sie verweigert sich durch ihre eigenartige Verquickung von Nostalgie und polnischem Katholizismus einem objektiveren Urteil.
Diese besondere Form von Ritualisierung der Musik scheint überhaupt ein Phänomen osteuropäischer Musik zu sein. Auch die Musik von Arvo Pärt, dem im Westen seit Jahren gefeierten estnischen Komponisten, ist geprägt von einer tiefen Religiosität. Und auch seine Klangsprache ist weitestgehend tonal und schlicht, und erzielt ihre Wirkung aus litaneiartigen Klangmodellen. An solcher Musik scheiden sich die Geister. Für die einen ist es nur „religiöser Wellness-Sound“ oder eine klassische Variante von „Sakro-Pop“, für die anderen „Klang gewordene Verinnerlichung“.
Auch der georgische Komponist Giya Kancheli und die russische Komponisten Galina Ustvolskaya müssen in diesem Zusammenhang genannt werden. Jedoch gibt es in deren Partituren, trotz aller Reduktion und Schlichtheit, nicht diesen nahezu ungebrochenen Wohlklang, wie er in Goréckis Sinfonie oder in der Musik von Arvo Pärt zu finden ist. Dennoch ist auch hier Mystik im Spiel, aber doch von ganz anderer Temperatur. Die Schlichtheit bei Kancheli ist eine bodenlose und verstörende, wirkt zerbrechlich. Die von Besetzung und Länge her großen Sinfonien (sechs hat er mittlerweile geschrieben) sind über weite Strecken kammermusikalisch ausgedünnt, meist einsätzig als langsamer Satz. Aber immer wieder bricht in die einsamen und verhaltenden Klänge und Melodien mit plötzlicher Brachialgewalt und Grellheit das volle Orchester ein, so, als wolle es das Gewesene auslöschen: wie ein schriller und lärmender Einbruch des Außen in das Innere. Aber in gewisser Weise sperrt sich auch diese Musik eigentlich einer wertenden Kommentierung. Hans-Klaus Jungheinrich schrieb über Kancheli: „Ist solche Mystik nicht doch eine monumentale Koketterie, probate Spielmarke auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten, wo auch das Leise und Lauterste sich zu behaupten trachtet nach den Gesetzen einer omnipräsenten Geschäftsmäßigkeit? Wo sie sich mit Geld und Marktmacht verbindet, ist auch Mystik verunreinigt; darüber kann gar kein Zweifel bestehen.“ Und er fährt fort: „Nichts, was auf dieser Welt geschieht, kann seine Reinheit bewahren. Nur das gänzlich Wirkungslose bleibt unbefleckt. Kommunizierte Musik ist demnach niemals reine Mystik; im Umgang mit dem menschlichen Tun und Treiben erfährt es allemal auch ihre Korrumpierung, der sie sich zugleich mit ihren Gestalten entwindet. [ … ] Wie aber stellt sich die Musik von Giya Kancheli dar? Baut sie sich vor dem Hörer auf, will sie imponieren, demonstriert sie ihr Anderssein, hüllt sie ihr Geheimnis in den Nebel von Programmen, Ideologien, ästhetischen Setzungen? Nein: sie ist nackt, kahl, schutzlos in ihrer zarten Verletzlichkeit, ihrer angefochtenen, beschädigten Fragilität. Sie ist Musik und nichts als Musik.“ Hören wir nun einen Ausschnitt der 4. Sinfonie von Giya Kancheli:
Klangbeispiel 4. Sinfonie (G. Kancheli)
Eigentlich ist die russische Komponistin Galina Ustvolskaya noch immer nur ein „Geheimtip“ unter Insidern. Eine breite Öffentlichkeit hat nie umfassender Notiz von ihr genommen. Und doch ist sie die vielleicht wichtigste russische Komponistin seit Schostakowitsch, bei dem sie übrigens studierte, und der ihr einzigartiges Talent früh erkannte, für das es aber in der offiziellen Musikszene Rußlands, in Konzerten und Notenausgaben keinen Platz gab. Viele Stücke von ihr wurden erst mit 20-jähriger Verzögerung publiziert, und einen ersten Durchbruch gab es erst 1992 beim Holland-Festival, wo mehrere ihrer Werke erklangen. Ihre Musik ist von geradezu beklemmender und kompromißloser Radikalität, etwas absolut Einmaliges in der Musikgeschichte! „Meine Musik hat auf keinerlei Weise irgendeine Beziehung zu irgendeinem anderen Komponisten.“, sagt Galina Ustwolskya, die übrigens bis heute ganz zurückgezogen in St. Petersburg lebt, und die Gespräche und Interviews ablehnt, und ebenso keine Fotos von sich zuläßt. Ihr Schaffen umfaßt nur knapp 30 Werke, und Bestellungen von Auftraggebern nimmt sie trotz schlechter Verhältnisse nicht an. Ihrem Verleger antwortete sie 1990 auf solch eine Anfrage: „Ich würde gern etwas schreiben, aber das hängt von Gott ab, nicht von mir.“ Der religiöse Aspekt tritt in ihrem Schaffen erst in den 70er Jahren auf, aber trotz christlicher Texte und Werktitel scheint ihr Gott ein sehr ferner zu sein, oder dann eher der zornige aus dem Alten Testament. Ich möchte Ihnen den Anfang der 2. Sinfonie mit dem Titel „Wahre und ewige Seeligkeit“ vorstellen, die 1978 entstand. Diese Musik bricht mit existentieller Macht und erbarmungsloser Härte auf den Hörer ein. Unerbittlich stampfen hier wenige, unterschiedlich dichte Clusterklänge durch die verschiedenen Orchesterregister und das obligat genutzte Klavier. Das kaum von der Stelle fortkommende und gleichförmige Stampfen im Forte „stolpert“ gelegentlich und unregelmäßig, wenn plötzlich einer der Schläge ein wenig kürzer ist. In diese extrem herbe und grell-düstere, fast monotone Klangwelt werden Zäsuren geschnitten, wo eine Stimme – mehr deklamierend denn singend – mit den Worten „Herrgott!“ (Gospodin!), „Ewigkeit“ (Vechmost) und „Wahrheit“ (Istina) zu hören ist, je dreimal, mehr nicht. Erst gegen Ende dieser gut viertelstündigen Sinfonie scheint dem verzweifelt wirkenden Stampfen die Energie zu schwinden, es wird stiller, ausgedünnter und versöhnlicher …
Klangbeispiel 2. Sinfonie „Wahre und ewige Seeligkeit“ (G. Ustvolskaya)
V. Ins Innere des Klanges
Auch der italienische Komponist Giacinto Scelsi hat stets mehr am Rand des offiziellen Musikbetriebs gelebt und gearbeitet. Auch er sprach ungern über seine Musik oder sich, und auch er ließ sich nicht auf Fotos abbilden. Aber sein „Weg nach Innen“ ist anderer Natur als der bei Galina Ustvolskaya oder den anderen eben erwähnten Beispielen. Es ist mehr eine aus dem Material selbst heraus suchende Art der Verinnerlichung zur Tiefe des Klanges hin. Sehr differenziert in den Aspekten der Spektralelemente und mikrotonaler Abweichungen von Tönen und Klängen, sehr subtil in den Variationen von Rhythmus, Intensität und Timbre sucht und findet Scelsi eine Klangsprache, bei denen herkömmliche Begriffe aus dem Musik beschreibenden oder analysierenden Vokabular kaum noch dienlich sind, ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Anfang der 70er Jahre erreichte die Musik Scelsis eine endgültige Vergeistigung in knappen Kompositionen, in denen kaum noch eine äußerliche Gebärde stattfindet. Der Tonraum kann sich bis auf einen einzigen Ton verengen. Was sich aber in und um diesen Ton herum ereignet, zeugt von unerhört konzentrierter Energie. Sein fünftes und letztes Streichquartett aus dem Jahr 1984 mag beispielhaft für diese Form der Reduktion stehen. Es besteht aus 43 „Klangobjekten“ um den Ton F, die ihn bis hin zu geräuschhaften Klangballungen ausdehnen. Ein karges und kahles Stück, komponiert und gedacht als Grabstein zum Gedächtnis an den Dichter Henri Michaux, dem engen Freund Scelsis, der kurz zuvor gestorben war.
Klangbeispiel 5. Streichquartett (G. Scelsi)
Die Erforschung von Mikrotonbereichen unter starker Betonung spektraler Obertonskalen und subtil schattierter Geräuschwerte zeichnet auch die Kompositionen des Italieners Salvatore Sciarriono aus. Seinen Stücken liegen oft sehr einfache Prozesse und klar erkennbare Formverläufe zu Grunde. Die fließenden Veränderungen von einem Klangzustand in einen anderen erscheinen dabei oftmals wellenförmig in einem langsamen Prozeß in die Zeit gedehnt: ein Atmen zwischen Licht und Schatten, flirrende Obertonfarben und Phasen spannungsvollen Schweigens. Die genutzten Gestalten bleiben trotz ihrer differenzierten Klanglichkeit für den Zuhörer faßlich. Die starke Körperlichkeit der wellenförmigen Strukturen ließe sich beispielhaft an seinem 1989 entstandenen Flötenstück L'orrizonte luminoso di Aton belegen, bei dem der Musiker bei gleich gegriffenem Ton dessen Obertonwerte abwechselnd durch Ein- und Ausatmen durch das Mundstück erzeugt. Einen Teil ihres Geheimnisses vermag diese Musik aber nur dann zu lüften, wenn das zuhörende Ohr sich auf die graduellen Veränderungen der Gestalten konzentriert. Hören wir den zweieinhalb Minuten dauernden Epilog der Azione invisibile per voce ,strumenti e coro Lohengrin: eine Stimme in fast volksliedhaftem Tonfall nur im A-Dur Dreiklang sich bewegend und darüber in ganz hohem Register ein irisierendes, dreigestrichenes Gis, das ist alles, was man hört, nur gegen Ende schiebt sich noch ein ganz dezenter Streicherklang darunter. Aber achten Sie in dieser scheinbar entwicklungslosen Musik einmal genau auf die feinen Unterschiede in der Deklamation und dem Reichtum der Melodiegestalten mit nur vier Tönen, die mit einer Singstimme den unberechenbaren rhythmischen Möglichkeiten die Tonfolgen eines Glockengeläutes zu imitieren scheinen, von dem im Text die Rede ist …
Klangbeispiel Epilogo aus: Lohengrin (S. Sciarrino)
„Alles ist noch immer wie es war – doch ist es anders.“ – „Man kann nur den Ton hören, den man selbst angeschlagen hat.“ – „Musik handelt vom Hören.“ – … dies sind aphoristische, in ihrer poetischen Verdichtung an Haiku gemahnende Notate von Hans Otte, die im Booklet der Einspielung seines Stundenbuches für Klavier aus dem Jahr 1991-98 zu finden sind. Sie zeugen von der vergeistigten Haltung des Komponisten bei seiner Arbeit, seinem auf den Ton und Klang selbst konzentrierten Denken, welches auch stark vom Zen beeinflußt ist. Eindringliches Beispiel dafür sind die beiden großen mehrteiligen Klavierzyklen, das eben schon erwähnten Stundenbuch aus 48 Einzelstücken und das 12-teilige Buch der Klänge aus den Jahren 1979 – 1982. Nur oberflächlich gibt es dort eine gewisse Verwandtschaft zur Minimal Music durch die vorkommenden Pattern-Modelle, doch schon allein die Art des musikalischen Vortrages, der alles andere als mechanistisch (wie z. B. bei Steve Reich) oder monoton (wie z. B. bei Phil Glas) ist, sondern vielmehr elastisch und expressiv in leichtem Rubato atmet, unterscheidet diese Musik gravierend von den amerikanischen Minimalisten, dem Interpreten fällt eine viel größere Mitverantwortung in der Notentextauslegung zu. Auch die Art der Nutzung vertrauterer Harmonien, und ihre Art der Verwurzelung in Tradition, ihre Nähe und Ferne zugleich sind durchaus verschiedener Art. Während die amerikanischen Minimalisten (und auch ihre europäischen Epigonen) fast ungebrochen zur Funktionsharmonik zurückkehrten, denkt Hans Otte zwar auch tonal, aber weitaus subtiler. Ich möchte das nur kurz an einem Beispiel erläutern, dem dritten Stück aus dem Buch der Klänge. Die ersten fünf Klänge, die jeweils siebenmal repetiert werden, und die zusammen wie eine harmonische Kreisform wirken, könnte man ganz entfernt mit einer klassischen Kadenz T – Tp – S – D – T vergleichen:
Und doch geschieht hier etwas anderes: in der Pulsation des Klanges ändert sich jeweils nur ein Ton beim Schritt in den nächsten Klang, und eine finale Wirkung entsteht schon allein deswegen nicht, weil bereits der erste Klang ein offener ist. Diese Klangfolge erscheint im ganzen Stück übrigens viermal, dazwischen geschoben sind von hier ausgehende und zurückkehrende weitschweifigere Harmoniefolgen, die den engen Radius des Tonraumes dieser ersten Klangfolge erweitern. Die schwebende Homogenität entsteht, ähnlich wie in Saties Vexations, aus der Nutzung meist übermäßiger Dreiklänge plus eines weiteren Tones zum Viertonklang; um mit traditionellem Vokabular zu reden: es sind vage Klänge. Wie in einem sich in Zeitlupe drehenden Prisma ändern sich die Klänge nach und nach und sind doch in ihren Intervallkonstellationen immer wieder ähnlich gebaut. Dabei genügen sie sich selbst in ihrer eigenen ihnen innewohnenden Schönheit und Offenheit, denen Interpret und Zuhörer in versunkener Wachheit folgen mögen. Oder – um mit Otte zu sprechen –: „Nichts hat seinen Grund außerhalb seiner selbst.“, denn: „Worte fügen wir immer nur hinzu.“
VI. Stille und Umkehr
Die Stille als Ort bewußten Hörens zu erleben, als Vorraussetzung für erinnernde Wahrnehmung und als Tor für den Weg ins Unbekannte und unvorhersehbar Offene, das scheinen mir einige Komponisten auf besonders eindringliche Weise in ihre Werke eingeschrieben zu haben. Bei Morton Feldman führt das zu Stücken, die mit einer Aufführungsdauer von fünf Stunden (z. B. beim 2. Streichquartett) auch dem Hörer ein ganz neues Hören abverlangen. Das Erinnern, und damit Umkehr zu so schon Gewesenem, wird bei ihm Bestandteil des Kompositionsprozesses selbst.
Bernd Alois Zimmermanns letztes Orchesterwerk aus dem Jahr 1970, geschrieben kurz vor seinem Freitod, trägt den Titel Stille und Umkehr. Auffälligstes Merkmal dieser Komposition ist der Orgelpunkt auf dem Ton D, der durchgehend bis zum Ende des gut 10-minütigen Stückes gehalten wird und der nur durch variierte Instrumentation im Verlauf seine Farbe und somit auch seinen Ausdruckswert verändert. Ebenso zieht sich ein Bluesrhythmus konstant durch das ganze Stück. Darüber wiederholen sich in verschiedenen Zeitabständen wechselnde Arabesken und Klangfigurationen. Das in seinen Mitteln sehr ausgedünnte und stets äußerst leise Orchesterstück ist in der Behandlung der Zeitstrukturen zwar noch von seriellem Denken geprägt (es betrifft also nur diesen formalen Aspekt) aber das emotionale Erscheinungsbild der Musik rückt diese seriellen Aspekte in den Hintergrund. Und so ist wohl auch der Titel zu verstehen. Was aber meint Zimmermann mit „Umkehr“? Ist es die Abkehr von den komplexeren Strukturen, eine Rückkehr zu faßlicheren Gestalten, oder ist gar eine Hinwendung zum Wesentlichen und Eigentlichen von Musik gemeint? – Bernd Alois Zimmermann hat sich selber nicht dazu geäußert. Aber es ist zu vermuten, daß der Titel mehr philosophisch denn musikalische Vorgänge beschreibend zu interpretieren ist. Umfassender ist er wohl auch als ein „Sich-zurücknehmen“ am Rande des Verstummens zu verstehen.
Klangbeispiel Stille und Umkehr (B. A. Zimmermann)
Noch eindringlicher findet bei Luigi Nono die zweifelnde und zugleich fordernde und bedingungslose Hinwendung zur Stille statt. Sicherlich markiert in dieser Hinsicht sein 1980 beim Beethovenfest in Bonn uraufgeführtes Streichquartett Fragmente – Stille, An Diotima einen besonderen Wendepunkt im seinem Werk. Gar von einer „Verwandlung in sein eigenes Gegenteil“ bei Nono sprach Heinz-Klaus Metzger. Aber nur oberflächlich betrachtet ist die in diesem Streichquartett stattfindende Hinwendung zur reinen Innerlichkeit ein Verlassen der Ideale von Revolution und sozialen Fortschrittsgedanken, wie es einige Kritiker zu erkennen glaubten. Es geht in diesem Streichquartett und auch den daraufhin entstandenen Werken um Anderes: zunächst rein kompositorisch um Prozeßdenken und Fragmentarisierung, und darüber hinaus um einen „Prozeß der Erkenntnis“, wie es Nono selbst sagte, der ihn vielmehr interessiere als „das Resultat eines Prozesses“. Dieser Prozeß findet in einer extremen Gestalt von Reduzierung statt. Wie, das möchte ich nun zum Schluß meines Vortrages an dem ersten Chorteil von Das atmende Klarsein zeigen, dem Werk von Nono, das direkt dem Streichquartett folgte. Diese Musik ist radikal ausgedünnt: nur der Einklang (Unisono), die Quinte und die Quarte als komplementäres Intervall werden verwendet, sozusagen Ton und Intervall im Urzustand. Es entsteht der Eindruck äußerster Transparenz und Reinheit. Beim Hören entzieht sich die Musik jeder metrischen Gliederung: die Zeit scheint stillzustehen. Werfen wir kurz einen Blick auf die harmonische Seite. Zunächst entsteht vom anfänglichen Fis aufbauend die Quinte Fis - Cis; das Cis bleibt liegen und führt weitersteigend in die Quinte der gleichzeitig einsetzenden Töne D und A. Trotz extremer Zeitdehnung addiert das Ohr diese Töne der kompositorischen Keimzelle zu einer Art D-Dur Septakkord mit Terz im Baß. Nach einer Atemzäsur entsteht nun nach dem gleichen Prinzip, quasi spiegelbildlich der fallende Quartgang: zunächst nacheinander einsetzend G und D, dann wieder gleichzeitig erklingend Gis -Cis. Durch melodisches Weitergehen des Soprans von Gis aus erscheinen mit Fis und Cis als fallendem Quartgang wieder die ersten beiden Töne. Nach einer erneuten Zäsur beginnt die nächste Phrase mit der Quart A - D als Komplementärklang zum Weitergehen am Beginn. Die sich anschließende fallende Quinte Gis - Cis verhält sich wiederum komplementär zur entsprechenden Quarte der zweiten Phrase. Schon dieser kurze Blick auf die harmonisch strukturelle Gestaltung des ersten Beginns läßt erkennen, daß trotz äußerster Schlichtheit der klanglichen Erscheinung alle Töne auf höchst differenzierte Art und Weise aufeinander bezogen sind. So, wie hier komponiert wurde, wird Tonkunst zu dem, was sie im emphatischen Sinn ist! Es kommt auf jeden einzelnen Ton an, auf seine Bedeutung im Zusammenklang in einfachsten Intervallverhältnissen!
Erst ein Blick in die Partitur läßt die höchst differenzierte metrische Fixierung erkennen, die allerdings durch zahlreiche Fermaten von 2 - 5 Sekunden Dauer etwas Irrationales bekommt, und die damit die Komplexität der Notation im klingenden Ergebnis wieder aufzuheben scheint. Aus dieser gleichzeitigen Schlichtheit und Komplexität spricht aber ein Höchstmaß an innerer Intensität, die auch an der ebenso detailliert notierten dynamischen Gestaltung und der Artikulation abzulesen ist. Diese Musik ist von höchst vergeistigter Haltung, die ihr tastendes Klangwerden im Suchen nach dem Neuen im schon Gewesenen findet. Und sie ist in besonderem Maße eine Zeitkunst, weil sie sich und dem Zuhörer Zeit läßt, in sie hineinzuhören. Sie ist ein Durchbruch in ein neues Land der Wahrnehmung. – In einem Vortrag, den Nono 1983 in Genf hielt, sagte er: Die Stille. Hören ist sehr schwierig. Sehr schwierig in der Stille die Andern zu hören. Andere Gedanken, andere Geräusche, andere Klänge, andere Ideen. Wenn man hören kommt, versucht man oft sich selbst in den Andern wiederzufinden. Seine eigenen Mechanismen, System, Rationalismus wiederzufinden, im Andern. Statt die Stille zu hören, statt die Andern zu hören, hofft man noch einmal sich selbst zu hören. [ … ] Musik hören. Das ist sehr schwierig.
… in diesem Sinne: versuchen wir es – noch einmal …
Klangbeispiel Das atmende Klarsein (L. Nono)
VII. Nachklang ( … in eigener Sache … )
Gleich im Anschluß wird Ihnen der Pianist Markus Bellheim Skulptur III op. 76, 3 von mir spielen. Es möge Sie noch einmal „live“ in den Zustand gesteigerter Wachheit beim Lauschen von stillen Klängen versetzen. Ich möchte deshalb nicht allzu viele Worte über das Stück verlieren, um ein möglichst „frisches“ Hören zu ermöglichen. Nur soviel sei gesagt: wesentlicher „körperlicher“ Bestandteil des Stückes ist die Verteilung der Töne auf die beiden Hände; trotz unterster dynamischer Stufe gibt es stets wahrnehmbare Lautstärkeunterschiede zwischen rechter und linker Hand (die rechte stets ein bißchen weniger leise). Eine Aufführung wird dadurch selbst zum Akt räumlichen wie skulpturalen Denkens. Für den, der es anschließend noch einmal nachvollziehen möchte, hier zusätzlich als Notenbeispiel der harmonische Verlauf des Stückes, der sich wie in extremer Zeitlupe über eine Viertelstunde erstreckt und so etwas wie eine Kreis-Modulation über die Kleinterz ist. Ein Modulations-Modell, das übrigens des öfteren bei Franz Schubert zu finden ist …
Doch zunächst an dieser Stelle: Dank für ihre Aufmerksamkeit auch dem gesprochenen Wort gegenüber.
|
© 2004 Michael Denhoff